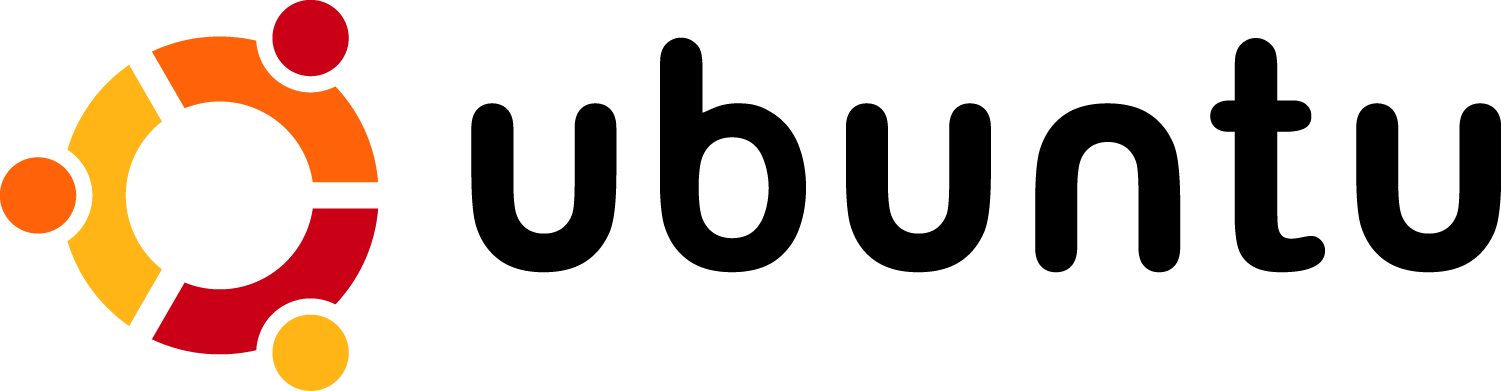Kleine Anfrage des Abgeordneten Uli König (PIRATEN) und Antwort der Landesregierung – Ministerin für Bildung und Wissenschaft
Schulspeisung/Schulverpflegung
Vorbemerkung des Fragestellers:
Es wird darum gebeten, die Fragen aufgeschlüsselt nach Schularten zu beantworten und dabei ausdrücklich die Schulen in freier Trägerschaft und die Schulen der dänischen Minderheit einzubeziehen.
Vorbemerkung der Landesregierung: Grundsätzlich verwalten die Schulträger nach § 47 Schulgesetz (SchulG) ihre Schul-angelegenheiten in eigener Verantwortung als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. Zu diesen in eigener Verantwortung wahrzunehmenden Aufgaben gehört sowohl die örtliche Bereitstellung von Schulgebäuden und -anlagen einschließlich der dem Schulbetrieb dienenden Mensen und Schulküchen als auch die Schulverpflegung. Vor diesem Hintergrund werden keine landesweiten Daten zur Ausgestaltung der Schulverpflegung bzw. der Schulküchen und Mensen erhoben. Landesrechtlich existiert eine Regelung zur Schulverpflegung lediglich insoweit, als eine Offene Ganztagsschule nur genehmigt werden kann, wenn unter anderem gewährleistet ist, dass an den Tagen mit Ganztagsbetrieb „ein warmes Mittagessen eingenommen werden kann“ (Ziffer 2.1 der „Richtlinie Ganztag und Betreuung“, Gl.Nr. 6642.25 Amtsblatt Schleswig-Holstein 2010, S. 1121ff.). Der Schulträger bzw. der jeweilige Träger der Ganztagsschule hat dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Infrastruktur und das entsprechende Angebot vorhanden sind.
1. Wie definiert die Landesregierung „Gesunde Ernährung“?
Antwort: Gesunde Ernährung ist Teil eines gesundheitsfördernden Lebensstils, dessen Stärkung und Erhaltung in der Lebens- und Arbeitswelt zu den erklärten Zielen der Landesregierung zählt. Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen bei der Entwicklung des Bewusstseins für gesunde Ernährung und verantwortungsvollem Umgang mit Lebensmitteln gestärkt werden. Grundlage für eine gesunde Ernährung in Kitas und Schulen bilden der „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ und der „DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erarbeitet hat. Neben den Referenzwerten für eine ausgewogene Ernährung gehören auch Aspekte wie der Geschmack der Kinder und Jugendlichen sowie entsprechende Rahmenbedingungen zu einer gesunden Ernährung.
2. In wie vielen Schulen erhalten Schülerinnen und Schüler ein gesundes Frühstück und/oder Mittagessen?
Antwort: Siehe Vorbemerkung.
3. Unabhängig von den vorherigen Fragen: An wie vielen Schulen erhalten Schülerinnen und Schüler ein Frühstück und/oder Mittagessen, das in Teilen oder im Ganzen durch nationale und/oder internationale Siegel (im Bereich Ernährung) zertifiziert wurde? Um welche Siegel handelt es sich dabei?
Antwort: Siehe Vorbemerkung.
4. Wie viele Schulen in Schleswig-Holstein sind mit a) eigenen Schulküchen b) Mensen ausgestattet und bereiten das angebotene Essen min. in Teilen vor Ort zu?
Antwort: Siehe Vorbemerkung.
5. Besitzt die Landesregierung Kenntnisse darüber, wie viele Schulen, die das Essensangebot mindestens in Teilen selbst herstellen, vorwiegend Angebote von regionalen Händlern/Anbietern verwenden? Wenn ja, wie sehen diese Kenntnisse aus?
Antwort: Siehe Vorbemerkung.
6. Wie viele Schulen in Schleswig-Holstein erhalten ihr Essen und/oder Lebensmittel von einem überregionalen Zulieferer?
Antwort: Siehe Vorbemerkung.
7. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung von Förderprogrammen zur Unterstützung gesunder Ernährung an Schulen, die a) vom Bund und b) von der EU gefördert werden? Wie sehen diese Kenntnisse im Einzelnen aus?
Antwort: a) Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans IN FORM hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) zusammen mit den Bundesländern „Vernetzungsstellen für die Schulverpflegung“ eingerichtet. Sie unterstützen bundesweit Schulen bei der Entwicklung und Qualitätsverbesserung eines ausgewogenen Verpflegungsangebotes in schulischen Einrichtungen. Die Vernetzungsstellen werden gemeinsam vom Bund und den Ländern gefördert. Ziel ist es, einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Schulverpflegung zu leisten. Die Bundesregierung fördert die Vernetzungsstellen degressiv über einen Förderzeitraum von zunächst fünf Jahren (2009 bis 2013). Bund und Länder haben sich grundsätzlich für eine zweite Förderperiode von 2014 bis 2016 ausgesprochen, nähere Einzelheiten liegen zurzeit noch nicht vor. Zurzeit ist kein Förderprogramm des Bundes zur Schulmilch bekannt. Allerdings hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) zwischen 2008 und 2010 das Bundesmodellvorhaben „Schulmilch im Focus“ initiiert, um Maßnahmen zur Steigerung des Schulmilchabsatzes zu identifizieren. b) Schulmilch: Bei der EU-Schulmilchbeihilfe handelt es sich um eine 100%ige Beihilfe im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL). Die EU fördert die vergünstigte Abgabe von Milch und Milchprodukten in Kindergärten, Vorschulen, Grundschulen und weiterführenden Schulen mit circa 75 Millionen Euro jährlich (18,15 Ct./Liter). Davon entfallen auf Deutschland rd. 6,5 Millionen Euro/Jahr, auf Schleswig-Holstein im Schuljahr rd. 170.000 €. Begünstigt sind pro Schüler und Schultag 250 Milliliter Vollmilch (Beihilfe ca. 5 Cent pro 250 Milliliter). In SH nehmen ca. 40% der Schulen bzw. Kindertagesstätten an dem Programm teil, allerdings fragen auch in diesen Einrichtungen längst nicht alle Kinder Schulmilch nach (Einzelheiten zur EU-Schulmilchbeihilfe in SH unter www.schleswig-holstein.de Stichwort Schulmilch). Vor dem Hintergrund des tendenziell rückläufigen Verzehrs an subventionierten Milchprodukten werden bundesweit zahlreiche Vorschläge, die zu einer Verbesserung des Schulmilchabsatzes beitragen könnten, diskutiert, darunter eine stärkere Verankerung des Themas ‚Nachhaltige Ernährung‘ in den Lehrplänen, eine Informationsinitiative zum gesundheitlichen Stellenwert von Milch sowie die Einrichtung von Schulmilchbeauftragten in den Schulen.
Schulobst: Die EU hat 2009/2010 erstmalig ein Schulobstprogramm in den Mitgliedsstaaten eingeführt. In Deutschland sind die Länder für die Durchführung und die in der Regel 50%ige Kofinanzierung des Programms zuständig. Es beteiligen sich sieben Länder am Schulobstprogramm (BW, BY, NW, RP, SL, ST und TH). Mit dem Schulobstprogramm werden jährlich europaweit 90 Millionen Euro Gemeinschaftsbeihilfe für die Mitgliedstaaten bereitgestellt. Deutschland stehen davon pro Schuljahr rd. 12,5 Mio. Euro zur Verfügung. Ergänzt wird das Programm durch die allein von den Mitgliedstaaten zu finanzierenden vorgeschriebenen begleitenden Maßnahmen, wie zum Beispiel Unterrichtseinheiten, Besuche auf dem Bauernhof oder auf Obstanbaubetrieben. Verteilt werden die Mittel auf Basis der 6- bis 10jährigen Kinder in den Mitgliedstaaten. Zielgruppe sind aber alle Kinder und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen.
8. Nehmen schleswig-holsteinische Schulen an a) bundesweiten oder b) europäischen Förderprogrammen teil? Wenn ja, welche Schulen sind dies und welche Förderprogramme werden genutzt? Wenn nein, welche Gründe sprechen dagegen?
Antwort: Zum EU-Schulmilchprogramm vgl. Antwort zu Frage 7; am EU-Schulobstprogramm beteiligen sich schleswig-holsteinische Schulen nicht, weil
die Umsetzung des Programms einen unverhältnismäßig hohen Personal- und Verwaltungsaufwand verursacht,
die Kofinanzierung der EU-Mittel nicht sichergestellt werden kann,
Schulträger und Kommunen die steuernde Funktion und die Kofinanzierung ablehnen.
Der Landesregierung liegen keine weiteren Erkenntnisse darüber vor, ob schleswig-holsteinische Schulen darüber hinaus an bundesweiten oder europäischen Förderprogrammen teilnehmen.
9. Welche Unterstützung bietet das Land Schleswig-Holstein den Schulen an, für gesunde Ernährung im Schulalltag zu sorgen?
Antwort: Seit 2009 fördert das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstel-lung (MSGFG) die Arbeit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Schleswig-Holstein bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V., Sektion Schleswig-Holstein. Die Förderung setzt sich aus Bundes- und Landesmitteln zusammen (vgl. auch Antwort zu Frage 7a). Die Vernetzungsstelle versteht sich als Ansprechpartner für alle Akteure rund um die Schulverpflegung und beteiligt sich an der Arbeit anderer Netzwerke (z.B. Netzwerk Ernährung, Netzwerk Gesunde Schulen mit Geschmack). Ziel und Aufgabe der Vernetzungsstelle ist es, Strukturen in den Schulen Schleswig-Holsteins zu schaffen, die eine schmackhafte, gesunde Verpflegung gewährleisten. Dies um-fasst neben der Verbesserung des Speisenangebotes für Kinder und Jugendliche auch eine nachhaltige Einbindung des Speisenangebotes in die Konzeption der Schulprogramme. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen SH (IQSH) hat das Netzwerk SH – Gesunde Schulen mit Geschmack initiiert und in diesem mit bedeutsamen Netzwerk-partnern (s.u.) Fortbildungsangebote für Schulen konzipiert. In enger Kooperation mit den Zukunftsschulen Schleswig-Holstein werden Schulen bei der Profilbildung hin zu einer „Gesunden Schule“ beraten und mit konkreten Fortbildungsangeboten unterstützt. Netzwerkpartner: BIOLAND e.V., Verbraucherzentrale SH, Landesvereinigung für Gesundheitsförde-rung in SH e.V., Techniker Krankenkasse, Vernetzungsstelle Schulverpflegung, Universität Flensburg – Institut für Ernährungs- und Verbraucherbildung, Zukunftsschu-le.SH, Service Agentur: Ganztägig Lernen Schleswig-Holstein, LandFrauenverband SH, Deutscher Kinderschutzbund Landesverband SH e.V./Kinderküche auf Tour, Die Feinheimischen.
10. Welche außerschulischen Einrichtungen, Initiativen oder Vereine unterstützen die Schulen, für gesunde Ernährung in den Schulen zu sorgen?
Antwort: Folgende außerschulischen Institutionen und Einrichtungen unterstützen schleswig-holsteinische Schulen: Vernetzungsstelle Schulverpflegung Schleswig-Holstein Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., Sektion Schleswig-Holstein Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. Schleswig-Holstein Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Schleswig-Holstein e.V. Universität Flensburg – Institut für Ernährungs- und Verbraucherbildung Techniker Krankenkasse BIOLAND e.V. Zukunftsschule.SH Service Agentur: Ganztägig Lernen Schleswig-Holstein, LandFrauenverband SH, Deutscher Kinderschutzbund Landesverband SH e.V./Kinderküche auf Tour Die Feinheimischen.
11. Gibt es regionale Unterschiede hinsichtlich der Verpflegungssituation an Schulen in Schleswig-Holstein? Wenn ja, wie sehen diese aus?
Antwort: Siehe Vorbemerkung.
12. Welche Konzepte hat das Land, um die Verpflegungssituation an den Schulen qualitativ wie quantitativ zu verbessern?
Antwort: Das IQSH wird in Kooperation mit den Zukunftsschulen.SH auch 2013 eine große Fortbildungsveranstaltung zum Thema Gesunde Ernährung konzipieren und umsetzen (24./25.09.2013). Schulen werden weiterhin beraten und als Gesunde Schule im Rahmen von Zukunftsschule.SH zertifiziert und erhalten regionale Unterstützung. Themenspezifische Fortbildungsangebote zu guter gesunder Ernährung bietet die Vernetzungsstelle Schulverpflegung (www.dgevesch-sh.de) an, mit der das IQSH eng kooperiert.
Drucksache 18/394