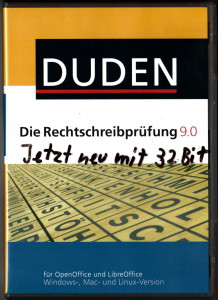Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Herr Stegner, ich finde es sehr interessant, dass Sie sagen: Wir wissen jetzt schon, wie wir die Lehrerabbauzahlen gestalten werden. Ich vermute einmal, die Aussage hat ein ähnliches Gewicht wie die Vorhersage von Herrn Albig, dass wir die Lehrerausbildung für Sek II für Physik und Chemie an der Universität Flensburg machen werden. – Ich bin gespannt. Ich finde es auch interessant, dass Sie sagen, ein Semesterticket sei der Ersatz der Fahrtkosten zu Praktika. Ich habe ein etwas anderes Bild von einem Semesterticket. Aber darüber können wir sicherlich noch im Ausschuss reden.
(Rasmus Andresen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie haben gar keine Ideen, das ist das Problem!)
– Doch, wir haben auch eine Menge Ideen.
(Zurufe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) „Wir werden die MINT-Ausbildung in diesem Land verbessern. Wir werden sie auf gleich hohem Niveau in Kiel haben, und wir werden sie in Flensburg haben. Wir wollen, dass dort Oberstufenlehrerinnen und -lehrer in Chemie, Biologie und Physik ausgebildet werden. Wir werden das sicherstellen. Wir werden das auch in den Haushalten abbilden. … Das wird diese Regierung sicherstellen. Das werden wir auch mit diesen Zahlen sicherstellen.“
– Und weiter:
„Dies ist – nehmen Sie das in ihrer Aufgeregtheit zur Kenntnis – der Wunsch eines Kieler Ministerpräsidenten …“ Das hat der Ministerpräsident, der leider gerade gegangen ist, am 9. April 2014 in diesem Haus so gesagt. Dazu gehört bemerkenswerterweise auch die Kausalität: Sie möchten gern wissen, was wir tun würden, wenn wir es getan hätten, was wir ursprünglich vorhatten. Das, meine lieben Kollegen, ist kein Wortfetzen aus einem x-beliebigen Gespräch in irgendeiner Eckkneipe nach Mitternacht, sondern die Einleitung einer Antwort der Bildungsministerin auf die Nachfrage der Kollegin Franzen aus der letzten Sitzung des Bildungsausschusses. In der Tat hätten wir in dieser Sitzung gern gewusst, welcher Stand der Beratungen denn nun der aktuelle ist. Wir hätten auch erwartet, dass der Ministerpräsident, der ja die Dokumentation der zugrunde liegenden Daten vollmundig im Plenum angekündigt hatte, seiner Zusicherung nachkommt und alle Modellrechnungen offenlegt. Das war bis zur Sitzung des Bildungsausschusses am 8. Mai 2014 nicht der Fall. Die Ministerin gab im Gegenteil zu, dass wesentliche Berechnungen gar nicht schriftlich verfasst und dargestellt sind, weil sie mündlich mit der Universität Flensburg vereinbart worden sind. In Anbetracht dieser bemerkenswerten Sachlage war ich gestern über die Klarstellung der Mehrheitsfraktionen froh, die fünf Tage nach der in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Bildungsausschusssitzung inklusive Wochenende kam. Es wird – im Gegensatz dazu, was Herr Albig angekündigt hat – keinen Unterricht in Chemie oder Physik auf Oberstufenniveau an der Universität Flensburg geben. Man wird auch darüber nachdenken, bestimmte Fächer auf Sek-I-Niveau zu belassen. Die Kosten – welche auch immer das nun sind – werden gedeckelt, und die Beratungen werden entschleunigt. Einen konkreten Fächerkanon werden die Hochschulen selbst vorstellen, auch wenn wir uns alle vorstellen können, dass es vornehmlich die günstigen Fächer sein werden. Wichtig ist, dass die Mehrheitsfraktionen – so ahnungslos sie hinsichtlich der tatsächlichen Kosten auch sind – mit dieser Festlegung die Basis dafür geschaffen haben, dass die Universitäten zum Verhandlungstisch zurückgekehrt sind. Das finde ich gut. Das lobe ich ausdrücklich. Die Fraktionen der Küstenkoalition haben die Fakten geschaffen. Sie haben die handwerklichen Mängel des Ministerpräsidenten und seiner Ministerin kassiert. Eines ihrer Prinzipien also, womit Frau Professor Wende noch am 9. Mai 2014 öffentlich in den „Kieler Nachrichten“ zitiert wird: „Eine Sek-I Ausbildung in Flensburg ist für mich tabu“, findet sich in dem Eckpunktepapier nicht mehr. Es ist also gut, wenn man noch ein paar Prinzipien zur Auswahl hat. In diesem Zusammenhang möchte ich mit der Mär aufräumen – Herr Stegner und Herr Andresen haben es gerade erneut wiederholt -, die Opposition beteilige sich inhaltlich nicht an den Beratungen. Das stimmt nicht. Hören Sie auf, das wie eine kaputte Schallplatte zu wiederholen. Es wird dadurch nicht wahr.Die PIRATEN haben sich nie geweigert, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Warum auch? Schließlich stehen wir hinter den Gemeinschaftsschulen. Wir wollen auch, dass diese gut ausgebildete und motivierte Lehrer haben.
( Rasmus Andresen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie haben nie etwas zur Lehrerbildung vorgelegt!)
– Wir haben Gespräche geführt, wir haben Anzuhörende benannt, wir haben Inhalte mit Kleinen Anfragen abgefragt. Und wir haben damit – es tut mir leid – in Gänze mehr getan als die Koalition. Wir haben allerdings auch kritisch zu Finanzierungsmodellen, zu Kapazitäten und zu Bedarfen und deren Umsetzungsstrategien nachgefragt. Die Zahlen dazu sind Sie uns noch schuldig geblieben. Wir haben dabei Mängel entdeckt – Mängel, die auch anderen nicht verborgen geblieben sind und die am Ende wohl auch die Mehrheitsfraktionen überzeugt haben. Sie folgen inhaltlich dem, was die CAU und die Opposition immer gesagt haben. Das ist gut so, aber vieles ist noch nicht vom Tisch.
An einem sehr praktischen Beispiel kann man veranschaulichen, was ich meine. Stellen Sie sich eine Familie vor, die von einer Wohnung in eine größere Wohnung umzieht. Diese Familie wird das dann zum Beispiel begründen mit: Wir bekommen Nachwuchs, wir brauchen mehr Platz. Da wird man sagen: Ja, die brauchen mehr Raum, das macht Sinn so.
Wir haben die Ministerin gefragt, warum sie Doppelstrukturen schaffen will, und hatten erwartet, dass sie uns konkret den Bedarf an Sek-II-Lehrkräften benennen wird. Sie hat es aber nicht getan. Sie hat lediglich darauf hingewiesen, dass man den Lehrerbedarf in den nächsten Jahren genauer prognostizieren wolle. Das ist zum einen gut, weil er im Moment fächer- oder schulartbezogen noch gar nicht bekannt ist. Zum anderen ist es aber für mich nicht schlüssig, zuerst die Kapazitätsentscheidung zu treffen und dann den Bedarf zu untersuchen. Da ist doch irgendetwas falsch herum gelaufen. Wir haben im Bildungsausschuss auch nach den konkreten Investitionen gefragt: Was soll wie wo in welcher Größenordnung warum investiert werden? Auch dazu machte die Bildungsministerin bis heute keine solide Angabe. Man habe das im Gespräch mit den Universitäten mündlich so vereinbart. Mit Verlaub, mit so einer Aussage beraubt man sich natürlich nicht nur selbst jeder Glaubwürdigkeit, man brüskiert auch den Rest der Menschen, die im politischen Raum Arbeit leisten. Ich habe einmal anhand einer willkürlich gewählten kleinen Gemeinde in diesem Land angeschaut, welchen Aufwand Kommunalpolitiker betrieben haben, wenn sie zum Beispiel eine Erweiterung einer Toilettenanlage im Kita-Bereich vornehmen wollen. Da geht von der Zielbeschreibung über grobe Kostenplanung bis zur detaillierten Kostenberechnung ein Jahr ins Land, um alle Gremien bis zur kleinsten Stelle hinter dem Komma zu informieren, Angebote zu erstellen, Planer zu beauftragen, die entsprechenden Ausschüsse einzubinden und schließlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Allein die Bildungsministerin hat das alles nicht nötig. Da wird mit dem großen Daumen gepeilt, da wird angenommen, vorausgesetzt, überschlagen und das Ganze am Ende im Gespräch vereinbart. Unterlagen, Berechnungen und Planungen gibt es dazu nicht. Einzig Herr Habersaat und Herr Andresen springen zur Seite, bezeichnen das Ganze als Popanz oder regen sich auf, wenn die Opposition nach Fehlern sucht. Lieber Kollege Habersaat, im Grunde haben Sie ja recht. Es ist eigentlich überflüssig, hier nach Fehlern zu suchen. Die Defizite sind so offensichtlich, dass man eigentlich gar nicht mehr danach suchen muss.
In den letzten Landtagssitzungen hat der Ministerpräsident selbst die Verantwortung für das Zahlenwerk der Bildungsministerin übernommen. In der letzten Bildungsausschusssitzung tat sie das selber nicht mehr, sondern pochte auf die Aufgabenverteilung im Kabinett: Wende macht die Inhalte, und Frau Heinold macht das mit den Finanzen. Nun ist es so, dass wir PIRATEN das Ziel des Stufenlehrers richtig finden. Aber die Umsetzung dieses Ziels muss handwerklich belastbar, ordentlich und solide sein. Das ist es, was wir unter seriös verstehen und bei dem wir offenbar weit von dem entfernt sind, was die Bildungsministerin darunter versteht. Ich verstehe nicht, wie Sie dort hinkommen. Es geht nicht um gut gemeint, sondern um gut gemacht – dies vor allem deshalb, weil es immer noch viele gibt, bei denen man die Idee des Stufenlehrers bewerben muss, damit man sie davon überzeugen kann. Wenn Sie aber so dünne Häuser bauen und sie auf Sand stellen, funktioniert das einfach nicht. Auch darum werbe ich für Transparenz und Offenheit. Wir haben noch Anhörungen vor uns. Vieles würde uns erleichtert werden, wenn wir wüssten, worüber wir reden.
– Liefern Sie uns die Fakten, dann wissen wir das endlich. Aber Sie liefern ja keine Fakten. Sie machen keine inhaltliche Debatte. Herr Albig, wir reden nicht nur über MINT, wir müssen auch über Kunst, Sport und Musik reden. Frau Wende, ich muss Sie korrigieren. Sie haben gestern im NDR gesagt: Einigung erreicht. Das suggeriert, dass das Gesetz in trockenen Tüchern ist. Das ist aber etwas ganz anderes als das, was mir mein parlamentarisches Verständnis sagt, dass wir mit den Beratungen nämlich erst angefangen haben. Das haben auch Sie heute gesagt. Ich empfehle Herrn Stegner, die Antworten der Landesregierung auf meine Kleinen Anfragen zu lesen. Dort nennt die Regierung selbst das Eckwertepapier als Grundlage für das Gesetz. Wir brauchen eine Modellrechnung, um die Einzelheiten der Daten für die Beurteilung jeder Planung zu beurteilen. Noch einen letzten Satz. – Der Sprecher des Ministeriums sagte gestern noch einmal ausdrücklich, dass jeder Blick auf Fächer selbstverständlich sei und dass dieser auch seriös berechnet und dargestellt werden könne. Das versteht sich von selbst. Der Mann hat recht. Es kann auch nicht schwer sein, diese Daten vorzulegen. Darauf bestehen wir PIRATEN.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.